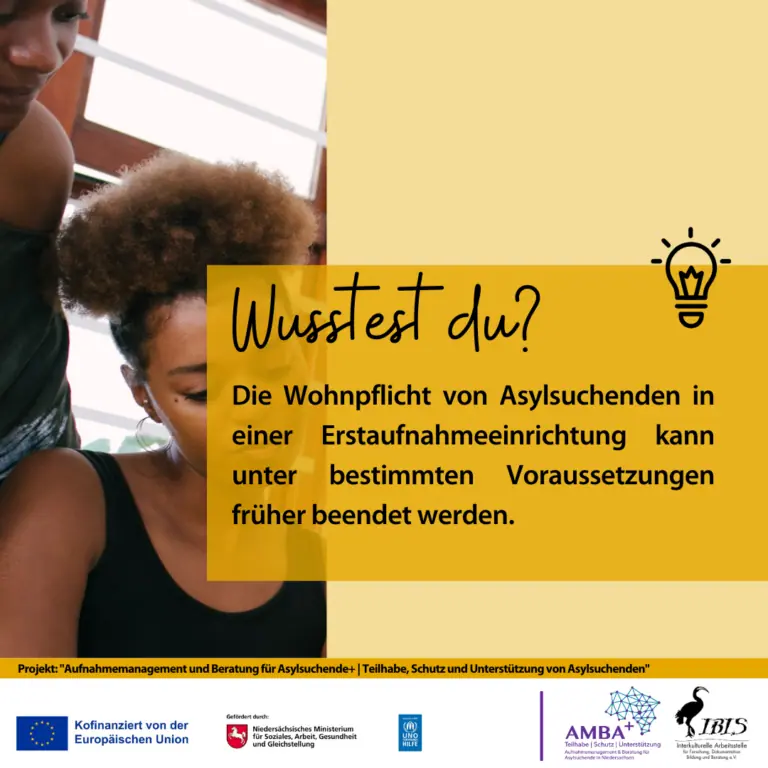
Unter bestimmten Voraussetzungen kann die Wohnpflicht von maximal 18 Monaten in der Erstaufnahmeeinrichtung früher beendet werden. Nach § 47 Abs. 1 S. 1 AsylG dürfen Asylsuchende mit minderjährigen Kindern nur
Die Zusammenstellung von Film-, Podcast- und Literaturtipps haben wir nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Dennoch kann es sein, dass einzelne Beiträge nicht oder nicht im Detail unsere Meinung wiedergeben. Nähere Angaben finden sich in unserem Impressum.
Auch Hilfsangebote und Beratungsstellen sind hier gesammelt. Die Antidiskriminierungsstelle von IBIS e.V. hilft in allen Fällen gerne weiter.
Wir hoffen, dass etwas Spannendes für Sie dabei ist!
Hören
Gesprochen wird über internalisierten Ableismus: dieses Phänomen tritt auf, wenn behinderte Menschen die Vorurteile und Diskriminierungen, die sie erleben, unbewusst verinnerlichen oder ihnen sogar bewusst zustimmen. Betroffene sprechen über ihre Erfahrungen mit ihrer Behinderung -> Was stellt es mit einem/einer an, wenn man täglich mit Ableismus konfrontiert wird? Wie kann man internalisierten Ableismus überwinden?
Lesen
Artikel von Rebecca Maskos zur Erklärung von Ableismus und dem Unterschied zum Begriff Behindertenfeindlichkeit
Hören
Anschauen
Ein Beitrag der Deutschen Welle; 8 Minuten; Mai 2020.
Lesen
Wo finde ich Hilfe?
Hören
Anschauen
Lesen
Wo finde ich Hilfe?
siehe Sexismus
Hören
Yekmal e.V. – Podcast: “Yekmal Podcast” | Interview: Antikurdischer Rassismus in Deutschland
mit Dastan Jasim, die Doctor Fellow am German Institute for Global and Area Studies ist und Merih Ergün von Yekmal e.V. ist, hier auf Spotify hören.
Lesen
Wo finde ich Hilfe?
Hören
Anschauen
Lesen
Wo finde ich Hilfe?
Hören
Anschauen
Lesen
Wo finde ich Hilfe?
Hören
Anschauen
Lesen
Wo finde ich Hilfe?
Hören
Anschauen
Lesen
Wo finde ich Hilfe?
siehe Antisemitismus
Hören
Anschauen
Lesen
Wo finde ich Hilfe?
siehe Antisemitismus
Hören
Podcastfolge 5: Gegenstrategien
Eine Folge der Podcast-Reihe über menschenfeindliche Ideologien der Amadeu-Antonio-Stiftung. Eine Folge widmet sich speziell Möglichkeiten, wie man rechten Ideologien begegnen kann. 2017.
Anschauen
Einige Tipps gibt Simone Rafael von der Amadeu-Antonio-Stiftung. Von Zeit Online, 2016.
Lesen
Dieser Beitrag greift gängige Schlagworte und Begriffszusammenhänge rechtsextremer Propaganda auf und unterzieht sie einer kritischen Analyse. Von Wolfgang Benz, Bundeszentrale für politische Bildung, 2006.
12 Richtigstellungen zu Antifeminismus und Gender-Kritik. Die Broschüre trägt falsche Behauptungen zusammen, stellt sie richtig und formuliert Gegenargumente. Vom Gunda-Werner-Institut und der Heinrich-Böll-Stiftung.
„Man darf ja nichts sagen, sonst ist man gleich Antisemit“. Was an dieser Aussage komisch und falsch ist beschreibt die Amadeu-Antonio Stiftung. Hier gibt es verschiedene „klassische“ antisemitische Sprüche samt Kritik.
Apps
Die App gibt dir die Möglichkeit Antworten und schlagfertige Argumente gegen Parolen zu üben und später passend im Alltag einsetzen zu können.
Wo finde ich Hilfe?
Argumentationstrainings von IBIS!
auch „Antiziganismus“ genannt.
Hören
Anschauen
Lesen
Wo finde ich Hilfe in Niedersachsen?
Über die Härtefallkommission können Ausländer_innen, die nach den sonstigen Bestimmungen des Aufenthaltsgesetzes kein Aufenthaltsrecht erhalten können, einem legalen Aufenthalt erhalten.
Lesen
Hören
Anschauen
Lesen
Wo finde ich Hilfe?
… für Betroffene?
… wenn ich austeigen will?
… für Angehörige?
… bei Zwangsheirat?
Hören
Anschauen
Lesen
Wo finde ich Hilfe?
siehe Rechtsextremismus
Hören
Anschauen
Lesen
Wo finde ich Hilfe?
Hören
Anschauen
Lesen
Wo finde ich Hilfe?
… wenn ich rechte Gewalt erlebe?
… wenn ich aussteigen möchte?
… wenn ich Angehörige habe, die rechte Gewalt erfahren haben?
… wenn ich in meinem Umfeld rechte Tendenzen bemerke?
Hören
Anschauen
Lesen
Wo finde ich Hilfe?
… für rechtliche Beratung?
… für Frauen und Mädchen?
… für lesbische, schwule, bi, trans*, inter* und queere Personen?
… für Männer und Jungen?
Hören
Anschauen
Lesen
Wo finde ich Hilfe?
siehe Sexismus und Rechtsextremismus
Hören
Anschauen
Lesen
Wo finde ich Hilfe?
Es gibt nur wenige Organisationen, die ausschließlich zu Verschwörungsmythen beraten.
Aber Hilfe gibt es auch bei Organisationen, die zu Rechtsextremismus beraten.
Es ist nicht immer einfach, sich alleine gegen Diskriminierung zu wehren. Zum Beispiel, wenn Sie bei Ihrer Arbeit durch den Chef oder die Chefin diskriminiert werden. Wir von IBIS e.V. wollen Sie genau in diesen Situationen unterstützen. Melden Sie sich bei unserer Beratungsstelle!
In Deutschland ist jede Person durch das Grundgesetz vor Diskriminierung geschützt. Das heißt, dass zum Beispiel eine Diskriminierung aufgrund von Religion oder Hautfarbe verboten ist. Außerdem schützt das Allgemeine Gleichstellungsgesetz (AGG) vor Diskriminierung.
Wenn Ihr Kind sich diskriminiert fühlt, ist es wichtig, dem Kind zu glauben. Geben Sie ihr_ihm das Gefühl, die Sorgen und Ängste ernst zu nehmen.
Bieten Sie ihr_ihm Hilfe an. Besprechen Sie gemeinsam, was es tun kann und wer helfen kann. Üben Sie mit Ihrem Kind, wie es in der Schule, im Sportverein usw. Hilfe holt. Sprechen Sie auch darüber, wie Beweise und Erlebnisse in Form eines Gedächtnisprotokolls festgehalten werden können.
Wenn Sie weitere Schritte unternehmen, wie z. B. das Gespräch mit Verantwortlichen suchen, tun Sie dies (altersgerecht) nur in Absprache mit Ihrem Kind. Entscheiden Sie alles gemeinsam mit dem Kind. Achten Sie auf die Wünsche und Bedürfnisse Ihres Kindes. Wenn Sie Unterstützung wünschen, können Sie sich z. B. an die Antidiskriminierungsstelle von IBIS e.V. wenden oder an eine ähnliche Einrichtung in Ihrer Nähe.
Auch in der Schule sind Sie rechtlich gegen Diskriminierung geschützt. Zum Beispiel über das Allgemeine Gleichstellungsgesetz (AGG). Möglicherweise hat auch die Schule Richtlinien gegen Diskriminierung. Bei erlebter Diskriminierung oder Gewalt sollten Sie sich an Vertrauenslehrkräfte oder Sozialarbeiter_innen wenden, um mit diesen das weitere Vorgehen zu besprechen. Gerne beraten wir Sie auch kostenlos und vertraulich bei IBIS e.V.
Auch in Freizeiteinrichtungen sind Sie gesetzlich gegen Diskriminierung geschützt. Wenn Sie Diskriminierung erfahren, können Sie Folgendes tun: Sie können das Gespräch suchen mit der Person, die Sie diskriminiert hat und den Vorfall ansprechen. Versuchen Sie möglichst sachlich die Situation zu beschreiben. Hören Sie sich die Darstellung Ihres Gegenübers an. Vielleicht können Sie so bereits eine Lösung finden.
Wenn Sie Unterstützung wünschen, können Sie sich z. B. an die Antidiskriminierungsstelle von IBIS e.V. wenden oder eine ähnliche Einrichtung in Ihrer Nähe. Hier erhalten Sie eine fachliche Beratung, wie Sie (rechtlich) vorgehen können und werden bei Gesprächen etc. unterstützt. Auf unserer Seite „Wissenswertes“ finden Sie weitere Beratungsstellen.
Wenn Sie weitere Schritte unternehmen, wie z. B. das Gespräch mit Verantwortlichen suchen, tun Sie dies (altersgerecht) nur in Absprache mit Ihrem Kind. Entscheiden Sie alles gemeinsam mit dem Kind. Achten Sie auf die Wünsche und Bedürfnisse Ihres Kindes. Wenn Sie Unterstützung wünschen, können Sie sich z. B. an die Antidiskriminierungsstelle von IBIS e.V. wenden oder an eine ähnliche Einrichtung in Ihrer Nähe.
Wenn die Polizei Sie körperlich angreift und/oder verletzt, ist das Polizeigewalt. Polizeigewalt kann auch rassistisch und diskriminierend sein.
Zum Beispiel, wenn die Polizei eine Person anders und schlechter behandelt, weil die Person nicht weiß ist. Was Sie am besten bei Polizeigewalt tun können, finden Sie hier: Kampagne für Opfer rassistischer Polizeigewalt.
Wenn Sie Diskriminierung erfahren haben, möchten Sie vielleicht rechtlich gegen die diskriminierende Person/Institution vorgehen. Dafür ist es wichtig, dass Sie Beweise für die Diskriminierung [Link zu “Diskriminierung oder Gewalt beweisen”] sammeln und die Situation gut festhalten. Es ist hilfreich, wenn Zeug_innen zur Verfügung stehen. Manchmal gibt es für rechtliche Schritte auch Fristen, die man einhalten muss. Deshalb ist es gut, sich nach der Diskriminierung bald Unterstützung zu suchen. Welche rechtlichen Schritte in Ihrer Situation möglich sind, kann Ihnen am besten ein_e Anwält_in sagen.
Wenn Sie diskriminiert werden oder Sie Gewalt erfahren, schreiben Sie am besten ein sogenanntes Gedächtnisprotokoll. Sie schreiben so genau wie möglich alles auf, an was Sie sich erinnern. Zum Beispiel:
Das hilft Ihnen, sich auch später noch an die genaue Situation zu erinnern. Fragen Sie am besten auch Zeug_innen nach:
Auch Beweise wie Fotos helfen.
Wenn Sie Zeug_in von Diskriminierung oder Gewalt werden, ist es gut, wenn Sie Beweise sammeln. Diese Beweise können Handyfotos oder Videos sein. Auch ein Gedächtnisprotokoll ist hilfreich (siehe Beweise). Sie können außerdem helfen, indem Sie eine Aussage bei der Polizei machen. Geben Sie der/den betroffenen Person(en) am besten Ihre Telefonnummer oder Adresse, damit sie sich bei Ihnen melden kann/können.
Wenn Sie Diskriminierung oder Gewalt beobachten, werden Sie aktiv! Ihre eigene Sicherheit geht dabei aber vor! Tun Sie nichts, wobei Sie sich unwohl fühlen.
Wenn Sie einen Übergriff auf der Straße bemerken, greifen Sie nur ein, wenn Sie sich dabei sicher fühlen. Fragen Sie Menschen nach Hilfe oder rufen Sie die Polizei.
Wenn Sie Zeug_in von Diskriminierungen werden, können Sie z. B. mit den Personen sprechen und sagen, dass das Verhalten nicht in Ordnung war. Handelt es sich um schlimme Diskriminierungen, können Sie eine Antidiskriminierungsstelle wie von IBIS e.V. einschalten. Fertigen Sie zu der erlebten Situation eventuell ein Gedächtnisprotokoll an (siehe Diskriminierung oder Gewalt beweisen).
Unterstützung können Sie in verschiedenster Form erhalten. Wenn Sie Diskriminierung und/oder Gewalt erfahren haben, wenden Sie sich an Familie, Freunde oder Bekannte. Es gibt auch diverse Einrichtungen, die Ihnen beratend und unterstützend zur Seite stehen können. Eine Liste mit verschiedenen Organisationen, an die Sie sich wenden können, finden Sie unter dem Punkt -> Links. Bei IBIS e.V. beraten wir Sie gerne in der Antidiskriminierungsstelle, der Beratung für Geflüchtete | Migrationsberatung oder dem Psychosozialen Zentrum für Menschen mit Fluchterfahrungen.
Wenn sich eine Person, die Gewalt und/oder Diskriminierung erfahren hat, an Sie wendet, nehmen Sie diese zunächst ernst und haben Sie ein offenes Ohr. Es ist häufig nicht leicht für betroffene Personen, über Gewalt-/Diskriminierungserfahrungen zu sprechen. Raten Sie der Person, ein Gedächtnisprotokoll anzufertigen und Beweise festzuhalten. Wenn sich herausstellt, dass eine schwerwiegende Gewalt-/Diskriminierungserfahrung vorliegt, sollten Sie ggf. anregen, eine Beratungsstelle hinzuzuziehen. Halten Sie jedoch stets Rücksprache mit der_dem Betroffenen.
Manchmal befinden sich Menschen in einer schwierigen Lebenssituation. Zum Beispiel, wenn eine wichtige Person in ihrem Leben verstorben ist. In dieser Zeit ist es nicht immer einfach, mit seinen Gefühlen umzugehen. Alle Menschen haben dafür ihre eigene Art, mit den Gefühlen und dem Ereignis umzugehen. Manchen Personen hilft es Sport zu machen oder zu arbeiten. Andere treffen sich lieber mit Freund_innen.
Nicht jede Art mit einer schwierigen Lebenssituation umzugehen, ist dabei gesund. Manche Menschen nutzen z. B. Drogen, um sich von schwierigen Lebenssituation abzulenken.
Wenn Sie das Gefühl haben, die schwierige Lebenssituation alleine nicht zu schaffen, ist es völlig in Ordnung, sich Hilfe zu suchen! Mögliche Hilfen sind zum Beispiel eine Therapie oder Suchtberatung.
Auch Fluchterfahrungen können eine schwierige Lebenssituation sein. IBIS e.V. kann Sie dabei unterstützen. Wir bieten eine kostenlose Beratung an. Das heißt, Sie müssen nichts bezahlen. Informationen finden Sie hier auf unserer Webseite.
Der Arbeitsmarkt ist ein Bereich, in dem es häufig zu Benachteiligungen kommt. Für viele Menschen ist es schwierig, überhaupt Arbeit zu finden. Eigentlich gibt es ein Gesetz, das Benachteiligung verhindern soll. Daran halten sich aber nicht alle.
Zum Beispiel stehen in Stellenausschreibungen Sachen wie: „Deutsch muss die Muttersprache sein“. Es gibt aber Menschen, die Deutsch nicht als Muttersprache haben, aber trotzdem sehr gut Deutsch sprechen. Diese Menschen haben dann keine Möglichkeit, die Arbeit zu bekommen.
Oft ist es für Menschen mit Migrationshintergrund oder mit einer Behinderung besonders schwierig, eine Arbeit zu finden. Manche Menschen beschweren sich dann. Oder sie machen eine Klage bei einem Gericht. Dann sagt der Arbeitgeber_innen oft, dass die Leute zu wenig für die Arbeit wüssten – obwohl das nicht stimmt.
Auch in Bewerbungsgesprächen wird oft diskriminiert. Es ist wichtig zu wissen: In Bewerbungsgesprächen dürfen nur Sachen gefragt werden, die wichtig für die Arbeit sind. Das heißt, es darf nicht gefragt werden nach: Religion, Alter, Schwangerschaft, Behinderung oder sexueller Orientierung.
Bei Behörden und Ämtern kommt es oft zu Diskriminierung. Zum Beispiel bei der Ausländerbehörde oder dem Sozialamt. Menschen mit Migrationshintergrund werden oft unfreundlicher behandelt.
Und auch das Geschlecht ist hier wichtig. Trans* Menschen werden oft in ihrem Geschlecht nicht respektiert. Trans* Menschen suchen sich z. B. oft einen neuen Namen aus, der zu ihrem Geschlecht passt. Wenn sie bei Behörden trotzdem mit ihrem alten Namen angesprochen werden, obwohl die Menschen von der Behörde darüber Bescheid wissen, ist das Diskriminierung.
Nicht alle Menschen kommen einfach so in Diskos oder Fitnessstudios. Beispielsweise werden sie am Eingang abgewiesen, weil Türsteher_innen Vorurteile gegenüber bestimmten Menschen haben. So ist es für Männer mit Migrationshintergrund oft besonders schwierig in die Disko zu kommen, genau wie für Frauen mit Kopftuch oder Menschen mit Behinderung. Auch in Restaurants werden Menschen mit Migrationshintergrund oft unfreundlicher behandelt.
In Bus und Bahn werden die Tickets kontrolliert. Das ist auch normal. Menschen, die als nicht weiß gelesen werden, werden aber viel öfter nach ihrem Ticket gefragt, als Menschen ohne Migrationshintergrund. Das ist unfair. Denn die Ticket-Kontrolleure und Kontroleurinnen tun dann so, als würden Menschen mit Migrationshintergrund nie ein Ticket kaufen.
Für Menschen mit Behinderung ist Bus und Bahn fahren auch schwierig. Sie werden manchmal gar nicht in den Bus gelassen. Busfahrer und Busfahrerinnen tun so, als würde sie die Menschen mit Behinderung nicht sehen und fahren vorbei.
Bei Krankenversicherungen werden Menschen oft wegen ihrem Alter diskriminiert. Ältere Menschen kriegen oft keine Hilfsmittel oder Operationen. Auch Menschen mit Behinderung kriegen oft keine Hilfsmittel oder Operationen.
Gegen diese Diskriminierung gibt es eigentlich ein Gesetz. Es gibt aber ein paar Ausnahmen. Zum Beispiel, wenn die Vermieter_innen im gleichen Haus wohnen. Wenn die Vermieter_innen aber 50 Wohnungen oder noch mehr vermieten, nennt man das „Massengeschäft“. Dann sagt das Gesetz, dass die Vermieter_innen niemanden wegen Herkunft, Behinderung, Geschlecht oder Religion diskriminieren dürfen.
Die Gesetzeslage ist also schwierig. Man muss im Einzelfall gucken, was gemacht werden kann.
Menschen mit Behinderung oder mit Migrationshintergrund finden oft keine Wohnung. Besonders Männer mit Migrationshintergrund haben Schwierigkeiten. Auch schwule oder lesbische Paare haben Schwierigkeiten bei der Wohnungssuche.
Die Vermieter und Vermieterinnen sagen dann oft, dass die anderen Mieter_innen dagegen wären, dass Menschen mit Migrationshintergrund oder Behinderung einziehen.
IBIS – Interkulturelle Arbeitsstelle e. V.
Klävemannstrasse 16
26122 Oldenburg
Telefon: +49 +441 88 40 16
Email: info@ibis-ev.de
handbook germany veröffentlicht stetig wichtige Informationen rund um das Asylsystem und die Rechte von Flüchtlingen.
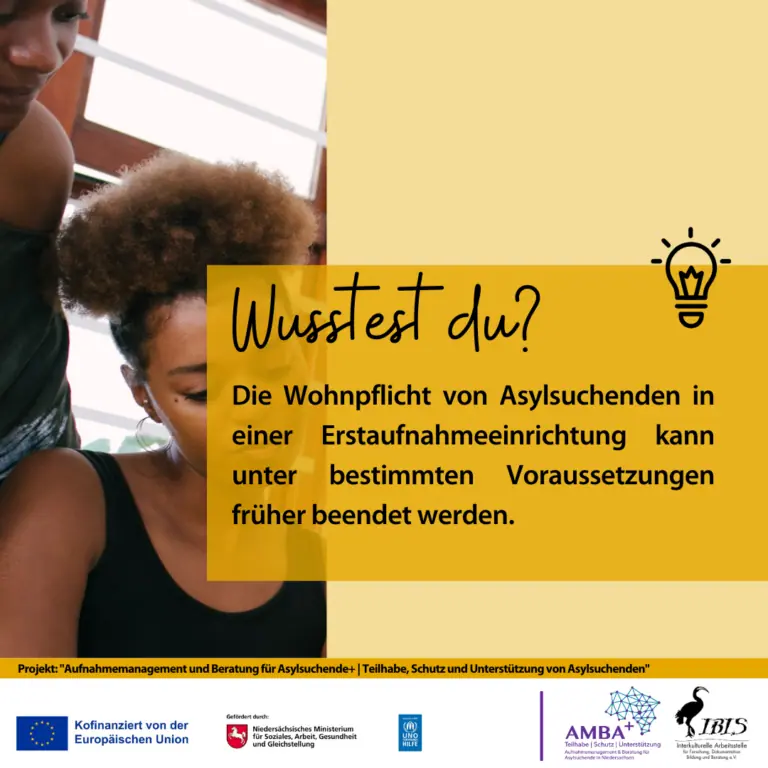
Unter bestimmten Voraussetzungen kann die Wohnpflicht von maximal 18 Monaten in der Erstaufnahmeeinrichtung früher beendet werden. Nach § 47 Abs. 1 S. 1 AsylG dürfen Asylsuchende mit minderjährigen Kindern nur

Asylsuchende in Deutschland dürfen unter bestimmten Voraussetzungen arbeiten, abhängig von ihrem Aufenthaltsstatus und der Dauer ihres Aufenthalts in Deutschland. In den ersten drei Monaten des Aufenthalts in Deutschland ist Asylsuchenden

Artikel 52 und 53 der Istanbul-Konvention verpflichten alle Vertragsstaaten zu kurz- und langfristige Schutzmaßnahmen für Asylsuchende, die von geschlechtsspezifischer Gewalt betroffen sind. In Deutschland werden diese Rechte durch das Gewaltschutzgesetz
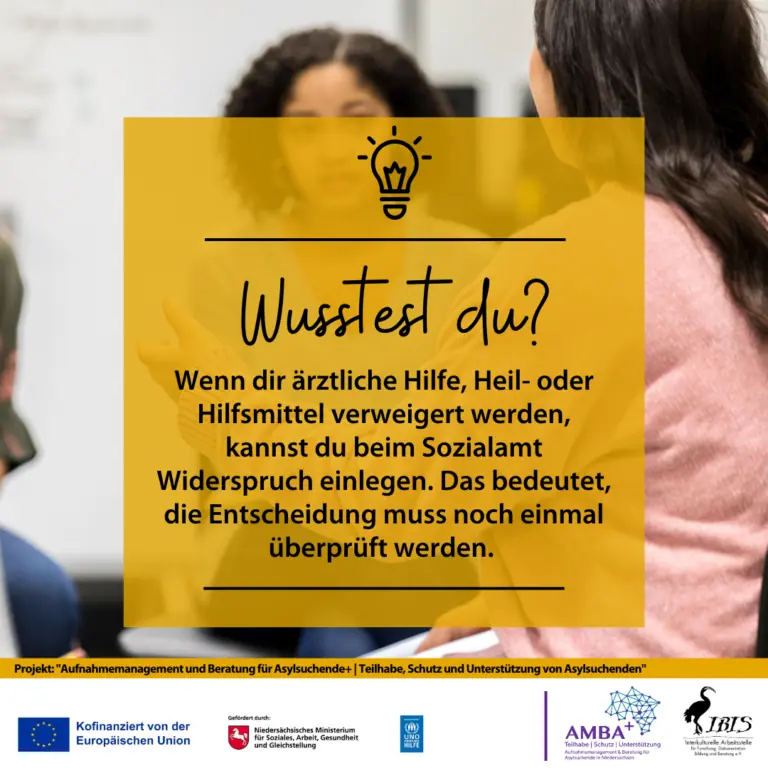
Wenn dir ärztliche Hilfe, Heil- oder Hilfsmittel verweigert werden, besteht die Möglichkeit beim Sozialamt Widerspruch einzulegen (§ 4a Nds. AG SGG). Dann muss die Entscheidung noch einmal überprüft werden. Dafür

Wenn du schon 18 Monate Asylbewerberleistungen erhältst, kannst du nach § 2 AsylbLG Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung beanspruchen. Diese Regelung ermöglicht einen Leistungsbezug auf höherem Niveau. Du erhältst eine Versichertenkarte
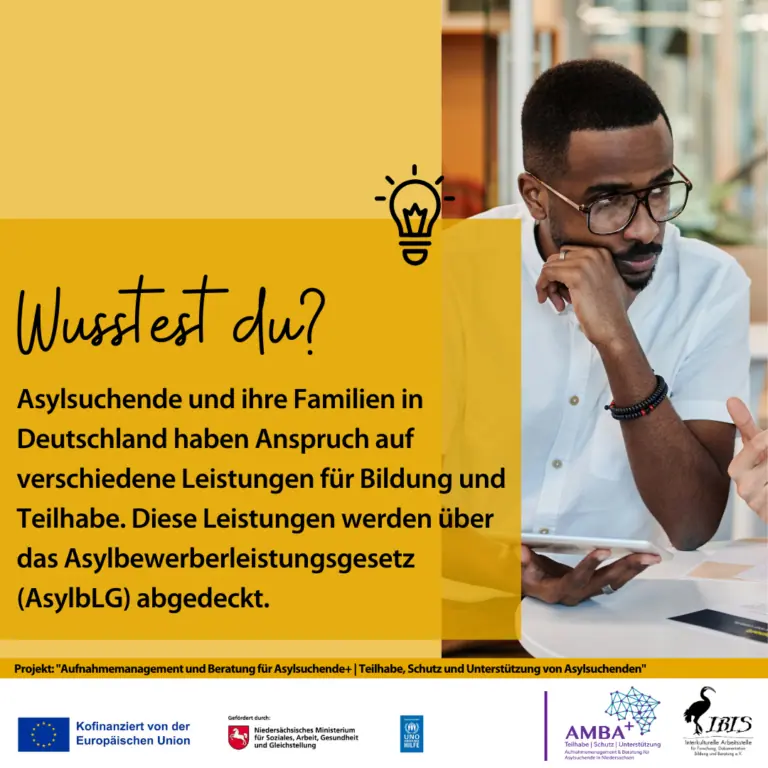
Asylsuchende und ihre Familien können Leistungen für Bildung und Teilhabe beanspruchen. Die Kosten werden über das Asylbewerberleistungsgesetz vom Sozialamt übernommen (§ 3 Abs. 3 AsylbLG i.V.m. §§ 34, 34a, 34b
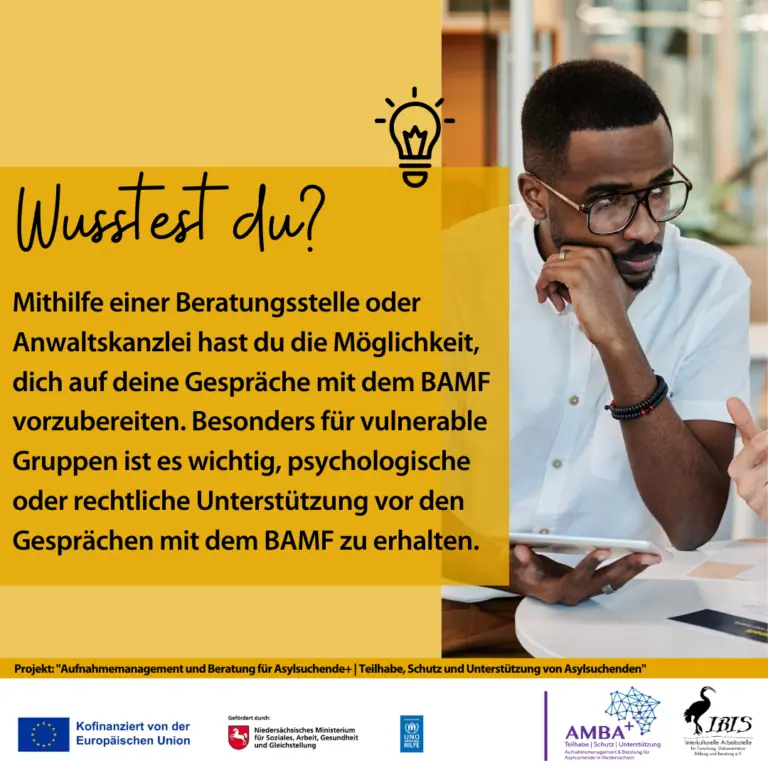
Mithilfe einer Beratungsstelle oder einer Anwaltskanzlei hast du die Möglichkeit dich auf die Gespräche beim BAMF vorzubereiten. Das ist besonders wichtig für vulnerable Gruppen. Dazu zählen zum Beispiel Schwangere, Kinder,
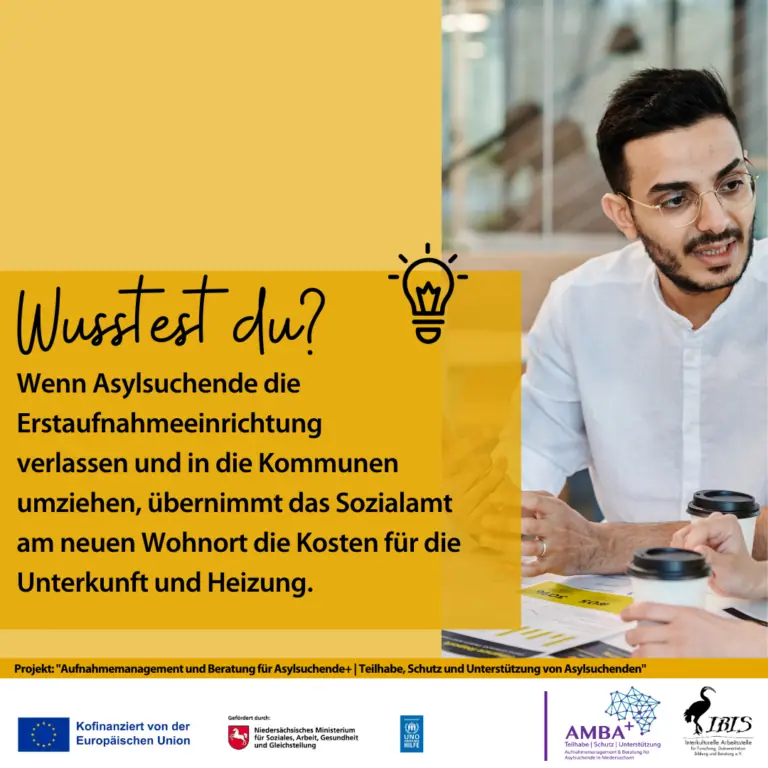
Das Sozialamt übernimmt für Asylsuchende die “angemessene” Miete, inklusive Heizkosten und Warmwasser, sobald sie von der Erstaufnahme in eine Kommune gezogen sind. Stromkosten werden nicht abgedeckt (§ 2 AsylbLG; §
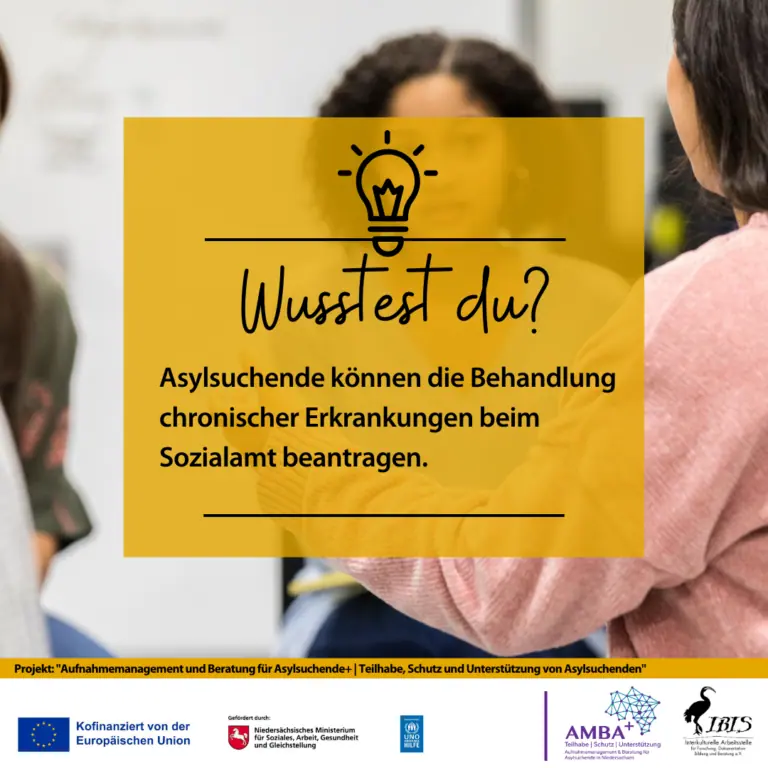
Asylsuchende haben nach § 6 AsylbLG Anspruch auf die Behandlung chronischer Erkrankungen, wenn die Behandlung unverzichtbar ist um die Gesundheit zu schützen. Auf Antrag beim Sozialamt wird geprüft, ob die
Klävemannstrasse 16
26122 Oldenburg
Telefon: +49 (0) 441 92 058 210
E-Mail: info@ibis-ev.de
Montag bis Freitag
9.00-13.00 Uhr & 14.00-16.30 Uhr
Wir verwenden Technologien wie Cookies, um Geräteinformationen zu speichern und/oder darauf zuzugreifen. Wir tun dies, um das Browsing-Erlebnis zu verbessern und um (nicht) personalisierte Werbung anzuzeigen. Wenn du nicht zustimmst oder die Zustimmung widerrufst, kann dies bestimmte Merkmale und Funktionen beeinträchtigen.
Klicke unten, um dem oben Gesagten zuzustimmen oder eine detaillierte Auswahl zu treffen. Deine Auswahl wird nur auf dieser Seite angewendet. Du kannst deine Einstellungen jederzeit ändern, einschließlich des Widerrufs deiner Einwilligung, indem du die Schaltflächen in der Cookie-Richtlinie verwendest oder auf die Schaltfläche "Einwilligung verwalten" am unteren Bildschirmrand klickst.